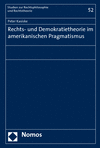Zusammenfassung
Der klassische Pragmatismus steht für einen amerikanischen Sonderweg in die philosophische Moderne. Auch die Entwicklung des amerikanischen Rechtsdenkens wurde durch den Pragmatismus von C.S. Peirce und John Dewey bis heute maßgeblich geprägt. Strömungen wie der "Legal Realism" oder die "Economic Analysis of Law" wären ohne das gedankliche Fundament der pragmatistischen Philosophie nicht denkbar.
Das Buch zeichnet den Einfluss des Pragmatismus auf die amerikanische Rechtstheorie über einen Zeitraum von 150 Jahren von Oliver Wendell Holmes" "The Common Law" bis zum modernen "Legal Pragmatism" eines Richard Posner nach. Der Verfasser veranschaulicht zudem den engen Zusammenhang, der zwischen der pragmatistischen Rechtstheorie und einem deliberativen Demokratieverständnis besteht. Für die Frage, wie das Spannungsverhältnis zwischen dem Willen des demokratischen Gesetzgebers und der Autonomie des Rechtssystems aufzulösen ist, kann der Pragmatismus neue Perspektiven liefern. Deshalb ist es lohnend, sich auch auf dem alten Kontinent mit ihm auseinanderzusetzen.
- 7–18 Einleitung 7–18
- 221–228 4. "The Common Law" 221–228
- 239–243 7. Holmes’ Pragmatismus 239–243
- 254–262 3. Der Legal Realism 254–262
- 262–293 III. Rechtspragmatismus 262–293
- 307–310 Schlussbetrachtung 307–310
- 311–330 Literaturverzeichnis 311–330
- 331–332 Personenverzeichnis 331–332